James Reddan, Monika Herzig, Michael Kahr (Hg)
The Routledge Companion to Jazz and Gender
Routledge. New York, London, 2023
498 Seiten, ca 33 Euro e-book
ISBN 978-3-95755-670-7
Dieser Reader wird auf Englisch veröffentlicht, in der Sprache der internationalen Jazzforschung. Sie ist anglo-amerikanisch geprägt.
Für deren deutsch-sprachige Sektion stellt er eine insofern eine Errungenschaft dar, als zwei der Herausgeber aus ihr stammen.
Die Pianistin Monika Herzig zog es in den 90ern von der Schwäbischen Alb an die Indiana University in Bloomington, wo sie seit etlichen Jahren unterrichtet.
Michael Kahr aus der Steiermark, gleichfalls Pianist, leitet das Jazzinstitut an der privaten Gustav Mahler Universität in Klagenfurt.
James Reddan, der Amerikaner in diesem Trio, ist Assistenzprofessor an der Western Oregon University und dort zuständig für „Choraktivitäten“ und „Musikerziehung“. Er würzt wie wenige andere unter den 46 AutorInnen seine Kurzbio mit den Formen seines Personalpronomens („he/him/his“). Das geschieht am Ende des Buches, kurz vor dem Index, der Zweck leuchtet an dieser Stelle (nicht mehr) ganz ein.
Wieder andere spoilern ihre Beiträge mit einem persönlichen Bekenntnis. Unter ihnen ragt Michael Kahr wortwörtlich hervor:
„Ich schreibe aus der Perspektive eines weißen, cis-gender, heterosexuellen Mannes aus der Mittelschicht, was mir ermöglicht hat, an der Jazzausbildung und dem anschließenden Berufsleben als Jazzpianist und -pädagoge teilzuhaben, ohne geschlechtsbedingte Nachteile zu erfahren. Da ich jedoch während meiner Studienzeit Zeuge mehrerer Vorfälle von Diskriminierung gegenüber Kollegen wurde - leider ohne mein persönliches Potenzial als Katalysator für Veränderungen zu erkennen -, ist dieses Kapitel allen Befürwortern von Vielfalt und Gleichberechtigung im Jazz gewidmet“.
Kann man sich vorstellen, dass Biologen in einem Reader ihre Beiträge ähnlich einleiteten?
Indes, hier geht es nicht um Sex, also das biologische Geschlecht, hier geht es schon ausweislich des Titels um Gender, die soziale Konstruktion und hauptsächliche Wahrnehmungsform von Geschlecht. Von diesem Phänomen - so erfahren wir aus dem Vorwort - seien derzeit rund 50 verschiedene Varianten in der Debatte.
Entwarnung vorweg, keiner der 38 Essays strebt bis in die letzte Verästelung der Geschlechter-Identitäten; vorwiegend geht es um die Großgruppen „cis-gender männlich“ und „cis-gender weiblich“; mit anderen Worten: um Männer bzw. Frauen, die sich gemäß ihres bei Geburt dokumentierten Geschlechtes verhalten, sei dies nun in hetero- oder homosexueller Praxis.
Und allein dort gibt es bekanntlich genügend Defizite oder auch Probleme.
Die meistzitierte Künstlerin in dem Band ist Terri Lyne Carrington mit 24 Nennungen (Carla Bley kommt auf 9). Das ist kein Zufall. Die Schlagzeugerin leitet in Boston das „Berklee Institute for Jazz and Gender Justice“. Und das verfolgt ganz ähnliche Ziele wie das Herausgeberteam hier:
„Ziel ist es, das Konstrukt von Gender in allen Formen des Jazz, der Jazzkultur, der Jazzgeschichte, der Intersektionalität von Geschlecht und Rasse sowie der Bildung zu identifizieren, zu definieren und zu hinterfragen, um den Diskurs über dieses wichtige Thema im Zusammenhang mit den sich verändernden kulturellen und gesellschaftlichen Normen weltweit zu gestalten und zu verändern“.
Black Masculinity
 Große Überraschung im ersten Teil, bei den der Historie zugewandten Kapiteln dieses Bandes: der Anteil der Frauen im frühen Jazz und Blues in New Orleans war nicht gering.
Große Überraschung im ersten Teil, bei den der Historie zugewandten Kapiteln dieses Bandes: der Anteil der Frauen im frühen Jazz und Blues in New Orleans war nicht gering.
Meist handelte es sich um Pianistinnen und Sängerinnen, einige von ihnen, z.B. Bessie Smith oder Memphis Minnie, zugleich auch „Sex-Arbeiterinnen“, wenngleich „die Anfänge des Jazz und ihre Interaktion mit dieser Sexökonomie (…) weniger ausgeprägt (waren) als die des klassischen Blues“ (Benjamin Barson, 28).
Und, Jazz kam keineswegs nur aus dem Bordell, nur aus Storyville (das 1917 im übrigen geschlossen wurde): Jazzperformances als Tanz fanden die Unterstützung von - man höre und staune - der Katholischen Kirche, Sozialclubs, von Fischbratereien.
Warum aber wandelte sich der - von heute aus betrachtet - beneidenswerte Umstand?
„Auch losgelöst von seinen Assoziationen mit Storyville behielt der Jazz seinen zwielichtigen Ruf, vor allem durch den Drogenkonsum von Jazzmusikern in den 1930er bis 1960er Jahren“, schreibt Sarah Caissie Provost.
Und verweist auf einen Imagewechsel: „Man nahm an, dass der jazzman ein Schwarzer war - trotz der Heerscharen von weißen Aneignern“.
Mit der Folge, dass „diese Hierarchie verhindert, dass Frauen (sowohl schwarze als auch weiße) im Jazz Erfolg haben; sie sind bedrohliche Kräfte, die den ´symbolischen und konkreten Beweis der afroamerikanischen Männlichkeit´ stören“.
Ja, die black masculinity, die heterosexuelle selbstverständlich, sie zählt zu den „heteronormativen Stereotypen“, die für die deutliche Unterrepräsentanz von Frauen oftmals herangezogen werden.
Aufschlußreich in diesem Kontext der Beitrag von Keith Karns, Leiter der Abteilung Jazz Studies an der Western Oregon University.
Unter dem Titel „Hard Bop Cool Pose“ verortet Karns diesen Typus Maskulinität zunächst in der Musik und der Haltung des Trompeters Lee Morgan (1938-1972), rückt aber, je weiter er auf die Gegenwart zustrebt, von rein inner-musikalischen Erklärungen ab.
Ein Kipppunkt ist das Poem des Trompeters Nicolas Payton „On Why Jazz isn´t cool anymore“.
Wenn aber Jazz nicht mehr cool sein soll, fragt Karns, „wie passen dann zeitgenössische Darbietungen von Jazz mit Maskulinität zusammen?“
In einer Landschaft, die er zutreffend so beschreibt:
 „In der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts war die Performance des Hard Bop weitgehend ein Ausdruck schwarzer Maskulinität, der von schwarzen Männern gemacht wurde, um etablierten Vorstellungen von schwarzer Männlichkeit zu untergraben und die weiße Hegemonie herauszufordern. Heute wird Jazz von einer internationalen, multi-
„In der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts war die Performance des Hard Bop weitgehend ein Ausdruck schwarzer Maskulinität, der von schwarzen Männern gemacht wurde, um etablierten Vorstellungen von schwarzer Männlichkeit zu untergraben und die weiße Hegemonie herauszufordern. Heute wird Jazz von einer internationalen, multi-
ethnischen und multi-gender Gemeinschaft gespielt“.
Mit anderen Worten, die Frage der Maskulinität wird mehr und mehr obsolet.
Eine ihrer Ursachen, die „Physikalität der Instrumente“, ist geklärt (jüngster Beleg unter vielen: Kalia Vandever, tb, Nicole Glover, ts, beim SWR New Jazz Meeting 2022).
Gleichwohl, die Defizite, Differenzen, Unterschiede allein schon der beiden cis-Geschlechter bleiben, wie die AutorInnen unisono beschreiben:
Musikerinnen sind bei Jazz-Wettbewerben benachteiligt; sie fühlen sich unwohl in einer männlich dominierten Band; es gibt empirische Daten über einen starken Rückgang von Schülerinnen in der aktiven Teilnahme am Jazz-Instrumentalunterricht auf dem Weg von der High School ins College, also: sie verlieren das Interesse am Jazz, das sie als Kinder noch hatten.
Und, Frauen schätzen das Risiko beim Improvisieren höher ein als Männer. Mit anderen Worten: sie trauen es sich weniger zu - wie mehrere Studien belegen.
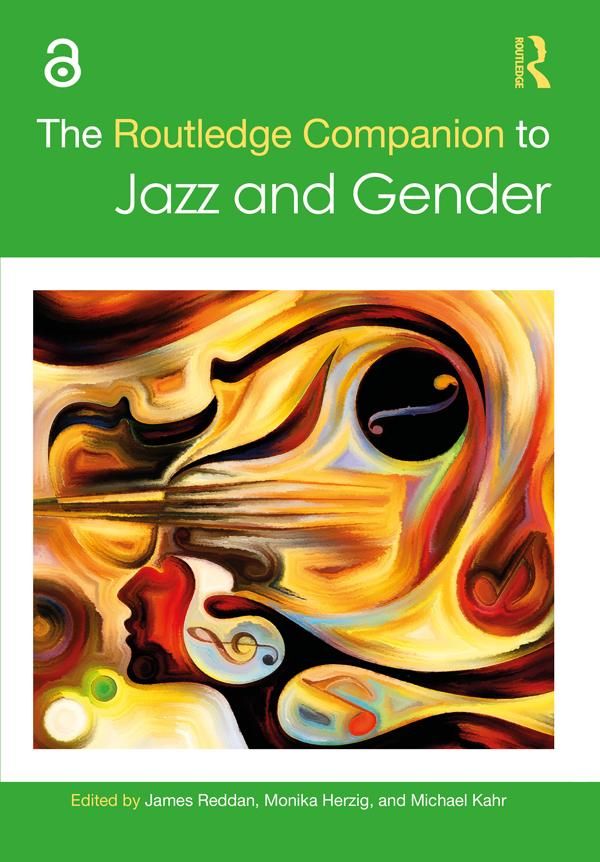 Der epischen Breite in der Schilderung von Mängeln & Defiziten steht nicht mal in Ansätzen erklärende Kompetenz aus den Feldern Soziologie, Erziehungspsychologie oder gar Philosphie gegenüber. Viele Autoren sind ex-MusikerInnen, nun Musikpädagogen, einige durchaus auch AktivistInnen.
Der epischen Breite in der Schilderung von Mängeln & Defiziten steht nicht mal in Ansätzen erklärende Kompetenz aus den Feldern Soziologie, Erziehungspsychologie oder gar Philosphie gegenüber. Viele Autoren sind ex-MusikerInnen, nun Musikpädagogen, einige durchaus auch AktivistInnen.
Unter ihnen fällt es leicht, auf bemerkenswerte Fehlbeschrei-
bungen zu stoßen. Zum Beispiel bei Melissa Forbes und Wendy Hargreaves (Australien), zwei Sängerinnen, die sich allen Ernstes der Frage widmen „CAN E-FLAT BE SEXIST? Canonical Keys as Marginalizing Practice in Jazz“
(Kann „es“ sexistisch sein? Kanonische Tonarten als ausgrenzende Praxis im Jazz).
Ihre Begündung:
„Kann ein ´es´ sexistisch sein? Ja. Wenn es als kanonische Tonart dargestellt wird, kann etwas so Einfaches wie eine Tonart geschlechtsspezifisch und diskriminierend sein. Es ist eine schlichte Tatsache, dass die Funktion der Stimme und das Erreichen eines authentischen weiblichen Vokaljazzstils mit den meisten kanonischen Tonarten nicht vereinbar sind“.
Ist diese Begründung nicht kurios?
Tonarten für Sängerinnen anzupassen, ist seit jeher Alltag von Arrangeuren.
(Wir haben zwei deutschen Arrangeuren die These von Hargreaves & Forbes vorgehalten, sie standen kurz vor einem Lachanfall.)
Und, haben nicht Ella Fitzgerald und etliche andere berühmte Sängerinnen, die mit Songs in den je für sie transponierten Tonarten aufgeführt werden, bewiesen, dass sie einen eigenen Stil gegen die „falschen“ Vorlagen erfolgreich entwickelt haben? (Die „falschen“ Vorgaben sind die „kanonischen“ aus dem Real Book, dem Verzeichnis der Standards.)
Begründungen und Erklärungen sind die Stärke des Bandes nicht, sie sind mitunter schwer nachvollziehbar. Der Fokus richtet sich nahezu exklusiv auf Künstlerinnen und Künstler im Bereich Jazz. Es fehlen Vergleiche zu Pop und Klassik. Wie kann man - beim Umfang dieses Bandes - benachbarte Großgattungen auslassen, wo zumindest in Teilbereichen Mängel weniger ausgeprägt sind?
Ebenso schmerzlich, das Stichwort audience: ein eigenes Kapitel über das Jazz-Publikum fehlt. Dort immerhin lässt sich in den letzten Jahren ein deutliches Anwachsen zumindest des weiblichen Anteiles beobachten.
Mit ein wenig rezeptionspsychologischer Expertise und weniger aktivistischem Furor hätte z.B. Natalie Boeyink in diesem Kontext Robert Glasper nicht so glänzend mißververstanden, als sie aus einem vielfach inkriminierten (und inzwischen zurückgezogenen) Interview zitiert, das der Pianist 2017 Ethan Iverson gegeben hat:
„Ich habe gesehen, was es mit dem Publikum macht, diesen Groove zu spielen (...) Um auf die Frauen zurückzukommen: Frauen lieben das. Sie mögen nicht so sehr die vielen Soli. Wenn du diesen einen Groove triffst und drauf bleibst, ist das wie eine musikalische Klitoris“.
Zugegeben, man mag Glaspers Wortwahl für vulgär halten. Boeyink aber insinuiert in ihrer Replik Dinge, die er gar nicht gemeint haben kann und die mit ein wenig Blättern in der einschlägigen Forschung als so falsch sich nicht herausgestellt hätten:
„Frauen zu unterstellen, sie seien nicht intelligent genug, um komplexe oder lange Jazzsoli zu schätzen, und sie auf ein Sexualorgan zu reduzieren, das er mit seiner Musik stimulieren kann, ist eine Erniedrigung von Jazzmusikerinnen und Frauen, die gerne Konzerte besuchen“.
Im Jazz-Schlaraffenland
Wo aber führte das alles hin? Wie sähe eine gerechte Geschlechter-Ordnung aus?
Viele befürworten eine Gleichstellung. Ihre Vorschläge laufen auf mentorship und role models hinaus, also: gezielte Unterstützung von Musikerinnen, mehr Frauen auf der Bühne.
Michael Kahr, einer der Herausgeber, versucht sich diesbezüglich an kontrafaktischer Geschichtsschreibung - eine Methode, die unter Historikern nicht die reine Freude hervorruft.*
Sein „Was wäre wenn?“ konzentriert sich auf Jazzgeschichte im Kleinen, auf das Beispiel der Jazzszene seiner Geburtsstadt Graz in der Steiermark.
Den tatsächlichen Ereignissen stellt er jeweils eine alternative Geschichtsschreibung entgehen.
Demnach hat 1966 - real - die Darstellung „schwarzer Maskulinität“ durch Mitglieder des Max Roach Quintetts in Graz doch einigen Unmut hervorgerufen.
Freddie Hubbard und James Spaulding mussten wegen zu viel Alkoholgenuss und ungebührlichen Benehmens auf der Bühne eine Nacht in Haft verbringen.
Die kontrafaktische, wünschenswerte Alternative liest sich bei Michael Kahr so - wie in einem Jazz-Schlaraffenland.
"Die Medien berichteten über die künstlerische Vielfalt und zeigten die musikalische Kompetenz der Journalisten, die oft selbst aktive Musiker waren. Alle eingeladenen Gastmusiker präsentierten ihre musikalischen Ansätze nicht nur auf Konzertbühnen und in Workshops des Jazzinstituts, sondern beteiligten sich auch an einer Vielzahl von Aktivitäten in öffentlichen Einrichtungen und Schulen. Häufig wurden die lokalen Jazzmusiker und ihre Gäste von den lokalen Politikern eingeladen, an politischen Diskussionen und Entscheidungs-
prozessen teilzunehmen. Gelegentlich traten die Gemeindevorsteher (von denen viele selbst eine musikalische Ausbildung genossen hatten) mit lokalen Musikern und Gastmusikern auf und reflektierten ihre künstlerischen Begegnungen anschließend in lebhaften Diskursen".
*(Die derzeit vom Historiker Dan Diner kuratierte Ausstellung „Roads not taken…“ im Deutschen Historischen Museum Berlin fällt nicht in diese Kategorie, sie setzt vielmehr auf die Kontingenz historischer Entscheidungen und nicht auf das Erzählen „ungeschehener Geschichte“.)
Fotos: , Günther Huesmann, SWR (Vandever, Glover)
erstellt: 04.12.22
©Michael Rüsenberg, 2022. Alle Rechte vorbehalten
