RALF VAN APPEN, ANDRÉ DOEHRING (Hg)
Pop Weiter Denken
Neue Anstöße aus Jazz Studies, Philosophie,
Musiktheorie und Geschichte
Bielefeld: Transcript Verlag, 2018
268 Seiten, 22,99 € print, 20,99 € PDF
ISBN: 978-3-8376-4664-1
————————————————————————————————————
Was sucht ein Buch dieses Titels in einem Jazzblog?
Zunächst sucht es einen Rezensenten. Und es hat ihn auch gefunden, über einen der Autoren sowie auch über den Untertitel.
Der Titel selbst lädt jazzheads ja nicht unbedingt ein. „Pop Weiter Denken“ - tut das nicht ein jeder Gedanke, der aus diesem Lager aufsteigt? Dem müssen wir an dieser Stelle nicht nachgehen.
Der Untertitel aber macht neugierig, „Neue Anstöße aus Jazz Studies, Philosophie, Musiktheorie und Geschichte“, der Untertitel bringt den wolkigen Haupttitel ins Lot.
Mit den Feldern aus dem Untertitel sind zu einem großen Teil auch die vier Kapitel des Bandes beschrieben. „Improvisation“, „Analyse“ und „Übertragungen“ sind Verschriftlichungen von Vorträgen einer Tagung im November 2017 an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz/A.
Die beiden Herausgeber Ralf von Appen (Uni Gießen) und André Doehring (Kunstuni Graz) sind ein eingespieltes Team, wobei letzterer auch in der Jazzforschung renommiert ist.
Das Feld „Philosophie“ war seinerzeit in Graz nicht vertreten, es ist ein Bonus dieses Bandes - und für sich schon hinreichende Kauflegitimation.
Wer „Philosophie des Jazz“ von Daniel Martin Feige nicht gelesen hat (manche scheuen sich davor), wird hier auf den Seiten 195-209 mit einer Kurzfassung bestens bedient.
Hier vertritt Feige auch seine Zentralthese
„Das, was im Jazz explizit ist, ist in der Tradition europäischer Kunstmusik implizit“, will heissen:
dass das „Werk“ (europäische Kunstmusik) durch seine Komposition nicht abschließend festgelegt ist, sondern sein Sinn durch jede neue Interpretation neu bestimmt bzw. verändert wird.
Im Jazz tritt dieser Sachverhalt viel offener zu Tage, wunderbar erklärt am Beispiel von leadsheet (Jazz) vs Partitur (Klassik).
„…ein Leadsheet ermöglicht anders als eine Partitur keine Entscheidung darüber, ob ein bestimmtes Spielen eines Standards fehlerhaft ist oder nicht.“
Mit anderen Worten: ich kann „Round Midnight“ ganz gegen die Anmutung des Titels und gegen die vorherrschende Spielpraxis in einem Affentempo spielen (wie es Miles Davis getan hat), ich kann die Melodie fragmentieren - und keine Jazzpolizei nirgends hat eine Handhabe dagegen.
„Der Standard (kann) in allen Tonarten, in allen Tempi, in allen Taktarten und in allen Stilen gespielt werden, ohne dass damit schon ein Fehler begangen worden wäre“ (DMF).
Nicht zufällig zitiert er in diesem Zusammenhang den amerikanischen Musikphilosophen Andrew Kania mit seinem Satz „All Play and no Work: An Ontology of Jazz“ (2011).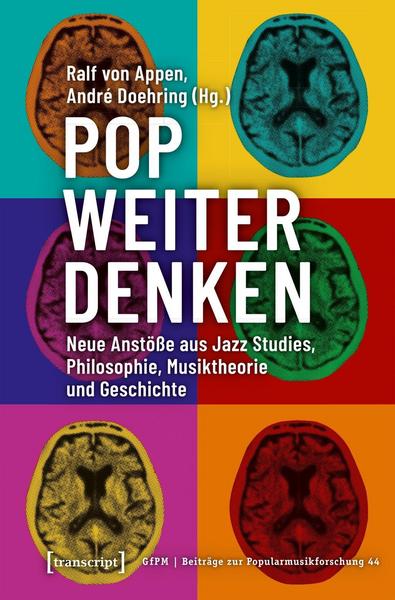 Gleich der Auftakt des Bandes, der erste von vier großen Abschnitten, „Improvisation“, widmet sich dezidiert Fragen des Jazz und nicht des Pop.
Gleich der Auftakt des Bandes, der erste von vier großen Abschnitten, „Improvisation“, widmet sich dezidiert Fragen des Jazz und nicht des Pop.
Martin Pfleiderer (Weimar) zeichnet die verschiedenen Zugänge zur gegenwärtig aufblühenden Improvisations-
forschung nach, aber auch deren Grenzen.
So zweifelt er beispielsweise, ob die von zwei anglo-ameri-
kanischen Autoren „favorisierte Fokussierung auf bewusste Spielentscheidungen zielführend ist“ und zieht zwei soziologische, auf Musikerinterviews basierende Studien heran, wonach die Ausführenden eher von einem „fast schlafwandlerischen Zustand“ berichten, „in dem weder entschieden noch überhaupt nachgedacht wird“.
Andreas Back und Peter Klose (TU Dortmund) haben Nämliches getan und ein Konzert der Dortmunder Band Filou (sic!) per Video aufgezeichnet und die Mitglieder anschließend befragt. Back & Klose sehen aber durchaus die begrenzte Gültigkeit ihrer Methode, die keine Unterscheidung zulässt, ob die Befragten ihre Gedanken während der Improvisation selbst (noch) reproduzieren oder dies bereits aus einer Beobachterperspektive tun.
Erstaunlich, dass in beiden Aufsätzen die m.E. bahn-
brechenden Studien des französischen Sozial-
wissenschaftlers Clement Cannone keine Erwähnung finden, der als einer der ersten versucht hat, den so schwierig zu erfassenden Gruppenkontext von improvisierenden Solisten anzusprechen.
Neben Daniel Martin Feige ist die Musikphilosophie auch mit Betrachtungen jenseits des Jazz prominent vertreten.
Am namhaftesten wohl durch Theodore Graczyk aus Minnesota, der unter dem Titel eines Carly Simon-Songs „You´re so vain“ („Du bist so eitel“), seinerzeit, 1972/73 gemünzt auf Warren Beatty, der Frage nachgeht, inwieweit damit eine reale Person beschrieben wird.
Graczyk beschreibt wunderbar den Unterschied zwischen Lyrik und Songtext, er kommt zu dem Schluß:
„Ein Songtext, der durch eine reale Person inspiriert ist, macht keine Erklärungen über diese Person, und verschiedene Aufführungen des Songs können verschiedene Weltbezüge aufweisen“ (…can yield different world-directed referents“).
Ebenfalls zwei Arbeiten widmen sich einem thematischen Fass ohne Boden, dem Verstehen von Musik.
Dirk Stederoth (Kassel) geht von einem wunderbar aphoristischen Stockhausen-Zitat aus („Manches, was ich schreibe, verstehe ich ja selber nicht“), gerät aber mit seinen Hinweisen auf „unbewusste Erfahrungen“ beim Komponisten wie seinen Zuhörern in Konflikt mit Erkenntnissen der Neurowissenschaften, beispielsweise eines Gerhard Roth, der betont: „Das Unbewusste ist sprachlich-gedanklich nicht zugänglich.“
Brillant hingegen und ein Vergnügen auch für jeden jazzhead „Music that changed my Life. Pop-Musik und Selbstverständis“ von Matthias Vogel (Gießen), das sich umstandslos auch auf Jazz-Erlebnisse übertragen lässt.
Vogel entschlüsselt, wie Musik zur Selbsterfahrung beitragen kann. Und er entwickelt in einer wunderbar kurzen „Einführung in die Theorie des Nachvollzuges“ ein Gegengift, das sich auch im Jazz bestens auf das semi-politische Interpretationsunkraut sprühen lässt.
Es sind Hammer-Sätze wie dieser „Wenn wir Musik als Musik (…) hören, dann entschlüsseln wir sie nicht, in dem wir Sachverhalte identifizieren, die mit ihrer Hilfe ausgedrückt oder repräsentiert werden.“
Er sollte als Gong auf einem jeden Jazz-Symposion in Deutschland erklingen.
Vogel versteht Musikhören als „tatsächliche Handlung“, etwa beim Tanzen, oder als „imaginierte Tätigkeit“.
Und Musikverstehen? Ein Hörer „muss nicht das Konstruktionsprinzip angeben können, das der Komposition eines Stückes zugrunde liegt, aber er muss es auf eine Weise hören können, vermöge deren die Klangereignisse zu einer strukturierten Erfahrunge beitragen.“
Ist das anti-Adorno? Yes, Sir, it is!
Auch der gute Ernst Bloch, 1885-1977 (und mit ihm alle Widerspiegelungsheinis in der Jazzpublizistik) wird auf den letzten Zeilen noch was an den Spiegel gesteckt. Vogel rüffelt dessen „krude Parallelisierung zwischen sozialen Schichten und musikalischen Stimmen“.
Zugegeben, mit diesen Bemerkungen ist ziemlich exakt nur die Hälfte dieses Buches erfasst. Es ist die Hälfte, die ein Jazzblog daraus selektieren und wozu er etwas sagen kann.
Den gleichwertigen Rest kann er zwar zur Kenntnis nehmen, aber nicht rezensieren. Er ist, bei punktueller Durch-
sicht, nicht minder anspruchsvoll und gewinnend.
Eine alles in allem sehr lohnende Lektüre.
erstellt: 12.03.19
©Michael Rüsenberg, 2019. Alle Rechte vorbehalten
