Wolfram Knauer
„Play yourself, man!“
Die Geschichte des Jazz in Deutschland
528 Seiten, 36 Euro (Taschenbuch 20 Euro)
Reclam, 2019
ISBN: 978-3-15-011227-4
Ja, ja, ja, das ist eine Fleißarbeit.
Gut 500 Seiten über „Jazz in Deutschland“: vom Auftritt der Fisk Jubilee Singers mit ihren Negro Spirituals in Darmstadt 1878 bis in die Gegenwart („Jazz wird diverser, weiblicher, queerer“), das ist ein Pensum von Berendt´schen Dimensionen.
Das gab´s noch nicht, und das wird sich so schnell auch niemand wieder aufbürden.
Er habe, sagt Wolfram Knauer, 61, „dieses Buch im Laufe von etwa anderthalb Jahren geschrieben“. Aber den Vorlauf dazu, „das Wissen, die Hörerfahrung, die kritische Distanz zu entwickeln, die dieses Buch ermöglichten“, die veranschlagt er auf mehr als vierzig Jahre.
Man glaubt es ihm gerne. Und möglicherweise ist auch niemand anders als der Leiter des Jazzinstitutes Darmstadt in der Lage, eine solche Aufgabe zu stemmen.
Ist er doch im täglichen Kontakt mit den dazu notwendigen Archivalien, digital (wie viele von uns von außen auch) und analog in unvergleichlichem Umfang, weil die zahllosen Exponante immer wieder durch Nachlässe wachsen, schon lange die Räume im historischen Bessunger Kavaliershaus sprengen und in Teilen auch ausgelagert sind.
Neben vielem anderen (u.a. einem exzellenten Service für externe Recherchen) symbolisiert dieses Pfundwerk eben auch die Leistungen eines Institutes, das bald 30 Jahre alt wird.
„Play yourself, man!“, man kann es nicht häufig genug betonen, behandelt den ganzen deutschen Jazz.
Der Band überwindet also das der Szene inhärente Schisma, bestenfalls den Zeitraum ab 1953 gelten (Erstes Deutsches Jazzfestival in Frankfurt, Erstausgabe von Joachim Ernst Berendt´s „Das Jazzbuch“) und alles davor vom Mantel der Geschichte verhüllen zu lassen.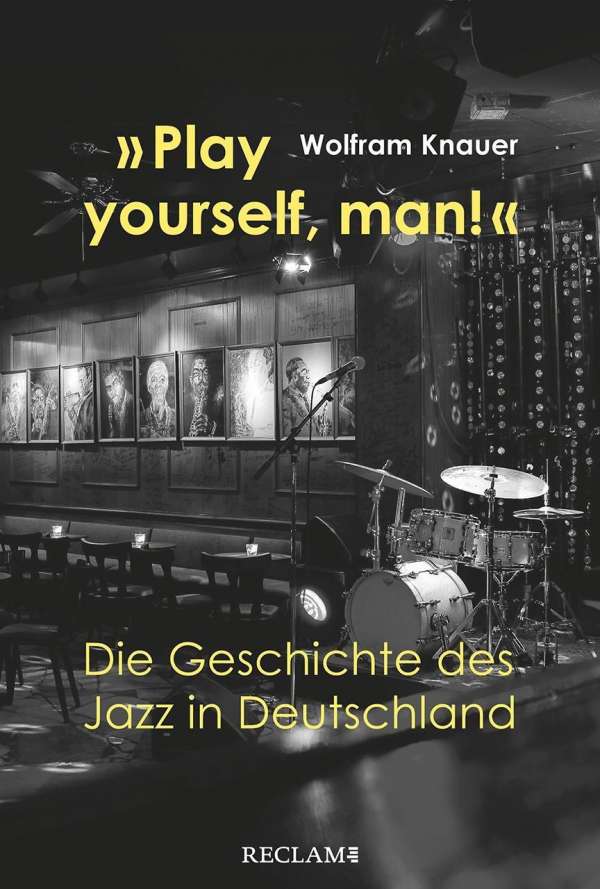
Knauer macht uns also bekannt mit dem Klarinettisten Eric Borchard (1886-1934), der gern „der erste wirkliche Jazzmusiker in Deutschland genannt“ wird.
Wir staunen über dessen Blütezeit, die Goldenen Zwanziger in Berlin, wo es eine klare Trennung nach Genres unter Musikern noch nicht gab („Die meisten Musiker verstanden sich als Tanzmusiker“), dazu „Engagements“ ohne Ende - aber auch erste Warnsignale, nicht ohne den bekannten rassistischen Unterton
(„Wie man als gesunder Mensch allerdings an dieser Nigger-Instrumenten-Klopferei Gefallen finden kann, ist rätselhaft“, findet die Deutsche Nachrichten Agentur am 4. März 1921).
Aber nicht nur in der Hauptstadt (mit damals 4 Mio Einwohnern) wogte die Jazzbegeisterung.
Er zieht eine Studie des Historikers Ralf Jörg Raber heran über die Frühzeit des Jazz in Essen, wo die Jazzmode „ähnlich vielfältig war wie in Berlin“. Demnach sind in den Jahren zwischen 1929 und 1932 allein drei verschiedene amerikanische „Frauen-Jazzkapellen“ an der Ruhr aufgetreten.
Das waren - ja Vergleiche hinken sowieso - gewissermaßen die „Mütter“ von Reichlich Weiblich (gegr. 1984); letztere fehlen in Knauer´s Chronologie ebenso wie das für die Ruhrmetropole bedeutendste Ereignis der Nachkriegszeit, die Essener Jazztage (1959-61).
Jazz in deutschen Diktaturen
Geschichtsunterricht dürften für viele Leser die Großkapitel „Jazzdämmerung“ (über die Jahre 1933-1945) sowie „Jazz in der DDR I: bis zum Mauerbau 1949-1961“ und „Jazz in der DDR II: Neue Freiheit hinter Mauern 1961-1989“ sein.
„Es gab also Jazz in Nazi-Deutschland, und Musiker konnten, sofern sie nicht jüdisch waren und damit unter die nationalsozialistischen Rassegesetze fielen, durchaus ihre Konzerte fortsetzen, Konzerte oder Ballabend spielen, Tourneen unternehmen oder Schallplatten produzieren.“ (89)
Mit einem „konsequenten und wirkungsvollen Verbot (war) es nicht weit her."
Knauer zitiert einen Pianisten namens Georg Nettelmann, der sogar in der Reichskanzlei aufgetreten sein soll, einzige Anweisung:
„Die erste halbe Stunde ist der Führer anwesend, da müsse man sich zurückhalten. Wenn er gegangen ist, geht´s los.“
Ausführlich äußert er sich über „Swing im Auftrag des Führers“, nämlich die 1939 vom Reichspropagandaministerium in Auftrag gegebene Band Charlie And His Orchestra,
ein besonderes Kapitel der jazzbezogenen „Schizophrenie der Nazidiktatur“.
Wie nicht anders zu erwarten vom Leiter einer öffentlichen Jazzinstitution zeichnet Wolfram Knauer die großen historischen Linien nach, er versagt sich Zuspitzungen, unkonventionelle ästhetische Wertungen, potenziell kontroverse Thesen. Sie vertrügen sich nicht mit dem Charakter eines, auch mangels Konkurrenz, Standardwerkes.
Knauer ist Mainstream; auch dort, wo er den gewissermaßer politischen Oberton des Jazz in Deutschland anstimmt. So gibt er typisch das Mantra über „68“ wieder, wenig durchdacht, überheblich gegenüber anderer Musik, ein Stück deutscher Jazz-Ideologie:
„Jetzt aber erhielt die Musik, ob sie es wollte oder nicht, eine politische und gesellschaftliche Relevanz, wobei die Improvisation unmittelbarere und authentischere Zugänge bot als die Diskussionen in Darmstadt oder Donaueschingen darüber, wie denn im Bereich der Neuen Musik die Gegenwart abbildbar sei.“ (263)
What´s missing, Man?
Wer die über 500 Seiten verdaut hat, erfährt einiges und weiß, wo er gerne tiefer graben möchte. Fundstellen gibt´s genug.
Last, but least, wie könnte es anders sein? Auch dem besten Vollständigkeitsanspruch (manchmal muss man bei der Lektüre an Hanns Dieter Hüsch´s persiflierenden Buchtitel denken „Du kommst auch drin vor!“, so vollzählig erscheint bei Knauer die Jazzgegenwart), auch dem besten Vollständigkeitsanpruch entgehen Kandidaten und Kandidatinnen; und wer sie aufzählt, behauptet nicht, dass er es besser könnte.
Wer oder was also fehlt?
Christoph Haberer und Uli P. Lask, zwei für den deutschen Jazz & Elektronik-Diskurs nicht ganz unmaßgebliche Köpfe. Wie gesagt, die Essener Jazztage fehlen (Vorläufer übrigens der Berliner Jazztage, ab 1964), die Essener Songtage auch.
Und außer Ekkehard Jost (1938-2017) übergeht der Autor die Vertreter der deutschen Jazz-Foschung/Philosophie, zum Beispiel Daniel Martin Feige, Herbert Hellhund, Alfons M. Dauer (1921-2010) sowie Martin Pfleiderer und Klaus Frieler, mit ihrer Weimar Jazz Database ein asset des Jazzstandortes Deutschland.
Knauer pflegt einen eingängigen Stil, die Lektüre fällt auch dort leicht, wo man die entsprechende Musik nicht unbedingt nachhören möchte.
Mitunter aber gleitet der saloppe Stil in Bereiche, wo ein anderer Tonfall notwendig wäre:
„Die Plattenindustrie war jedenfalls auf beiden Seiten des Atlantiks im Aufschwung, als der Erste Weltkrieg dazwischenfunkte und die Verkaufszahlen einbrechen ließ.“ (41)
Ganz zum Schluß, in dem Absatz „Jazz wird diverser, weiblicher, queerer“, ruft der Autor sich selbst zur Ordnung. Der Obertitel des Buches, der ästhetische Imperativ des Jazz („Play yourself, man!“), der immerwährende Gültigkeit besitzt und den ein(e) jede(r) versteht, der je von dieser Musik gefangen wurde, er kommt Knauer selbst nun komisch vor - er müsste doch „inzwischen auch geschlechtergerecht artikuliert werden“.
Also, „Play yourself!“ - Geht doch.
erstellt: 22.10.19
©Michael Rüsenberg, 2019. Alle Rechte vorbehalten
