Daniel Martin Feige, Gesa zur Nieden (Hg)
Musik und Subjektivität
Beiträge aus Musikwissenschaft, Musikphilosophie und kompositorischer Praxis
326 S., 45 Euro
Transcript, 2022
Die Musikphilosophie - über die einer ihrer nicht ganz unbedeutenden Vertreter Richard Klein (1953-2021) in seiner „Einführung“ (Junius, 2014) kokett befand, „es gibt sie gar nicht“ - zeigt sich derzeit nicht allein in ihrem deutsch-sprachigen Zweig in einem erfreulich vitalen Zustand.
Für Mai 2022 kündigt Suhrkamp „Betrachtungen zur Musik“ von Ludwig Wittgenstein (1889-1951) an; zum Jahreswechsel 2021/22 lieferten sich zwei Bände ein photo finish um den Platz in den wenigen Regalzentimetern, die der Buchhandel dafür wohl noch freizuhalten bereit ist.
Die inhaltlichen Schnittmengen sind geringer als die jeweils in beiden Bänden vertretenen Autoren vermuten lassen. Obendrein gastieren sowohl Claus-Steffen Mahnkopf als auch Wolfgang Fuhrmann, die Herausgeber von „Perspektiven der Musikphilosophie“ (Suhrkamp, 2021), bei „Musik und Subjektivität“.
Wohingegen zwar Daniel Martin Feige, nicht aber die Mitherausgeberin, seine Ehefrau Gesa zur Nieden, bei „Perspektiven…“ mit einem Beitrag vertreten ist.
Wir wollen nun nicht schon wieder die olle Hanns Eisler-Kamelle bemühen (Sie wissen schon: wer nur von X was versteht, versteht auch von X nichts), aber dass „Musik und Subjektivität“ hier, in einem, naja, jazz blog, zur Rezension ansteht, hat mit Daniel Martin Feige zu tun.
Er hat mit „Philosophie des Jazz“ (2014) die Diskussion in unserer kleinen Welt angeschoben (obwohl sich diese nur in Teilen dafür empfänglich zeigte). Feige ist ein ungemein produktiver Geist, seine gesamten gegenwärtigen, publizistischen Aktivitäten können hier gar nicht abgebildet werden. Sie tun auch nichts zur (Jazz)Sache.
Jedenfalls äußert er sich dazu bei Mahnkopf/Fuhrmann gar nicht und in diesem Band lediglich am Rande. Insoweit überrascht, dass der von ihm als Co-Herausgeber delegierte Jazzbereich in zwei Beiträgen nur suboptimal bestellt ist (dazu später mehr).
Denn zunächst einmal springt Matthias Vogel ins Auge. Der Musikphilosoph aus Gießen, geb. 1960, zündet zuverlässlich gedankliche Aufreger. Darüber berichten wir an dieser Stelle spätestens seit „Pop Weiter Denken“.
Seine Beiträge dort, aber auch bei Mahnkopf/Fuhrmann und jetzt wieder in „Musik und Subjektivität“, entfalten jeweils Facetten des ewig grünen Themas Musik & Verstehen.
Vogel kommt in diesem Band erst auf Seite 156 vor („Musik als Medium der Selbstbegegnung. Eine Notiz mit Fußnoten“). Aber für uns ist er, aus Erfahrung, ein opener.
„Weil man mit Musik nichts sagen kann, kann man mit ihrer Hilfe auch nicht ´ich´ sagen. Und weil man mit Musik nicht ´ich´ sagen kann, kann man mit ihrer Hilfe auch nichts über sich sagen. Insofern Musik kein repräsentationales Medium ist, kann sie also kein Medium sein, in dem sich grundlegende Merkmale des Subjektiven, der Perspektivität, des Selbstbezugs oder der Selbstreflexion zeigen oder realisieren ließen“.
Das ist der Vogel-Sound. Und, zugegeben, es bereitet immer wieder eine diebische Freude: wie er erstmal alles auf den Kopf stellt, also hier dem Motto des Bandes zu widersprechen scheint.
Seine Überlegungen zielen auf Musik allgemein, aber der Jazz mit seiner kultischen Verehrung des Subjektiven, des Individuellen, kann insbesondere adressiert sein.
Vogel macht rasch klar, dass „die obigen Behauptungen nicht das letzte Wort zum Verhältnis von Musik und Subjektivität bleiben sollten“. Selbstverhältnis und Selbstverständnis „ihrer Hörer:innen“ sieht er am besten darin realisiert, wenn Musik als Musik gehört wird“.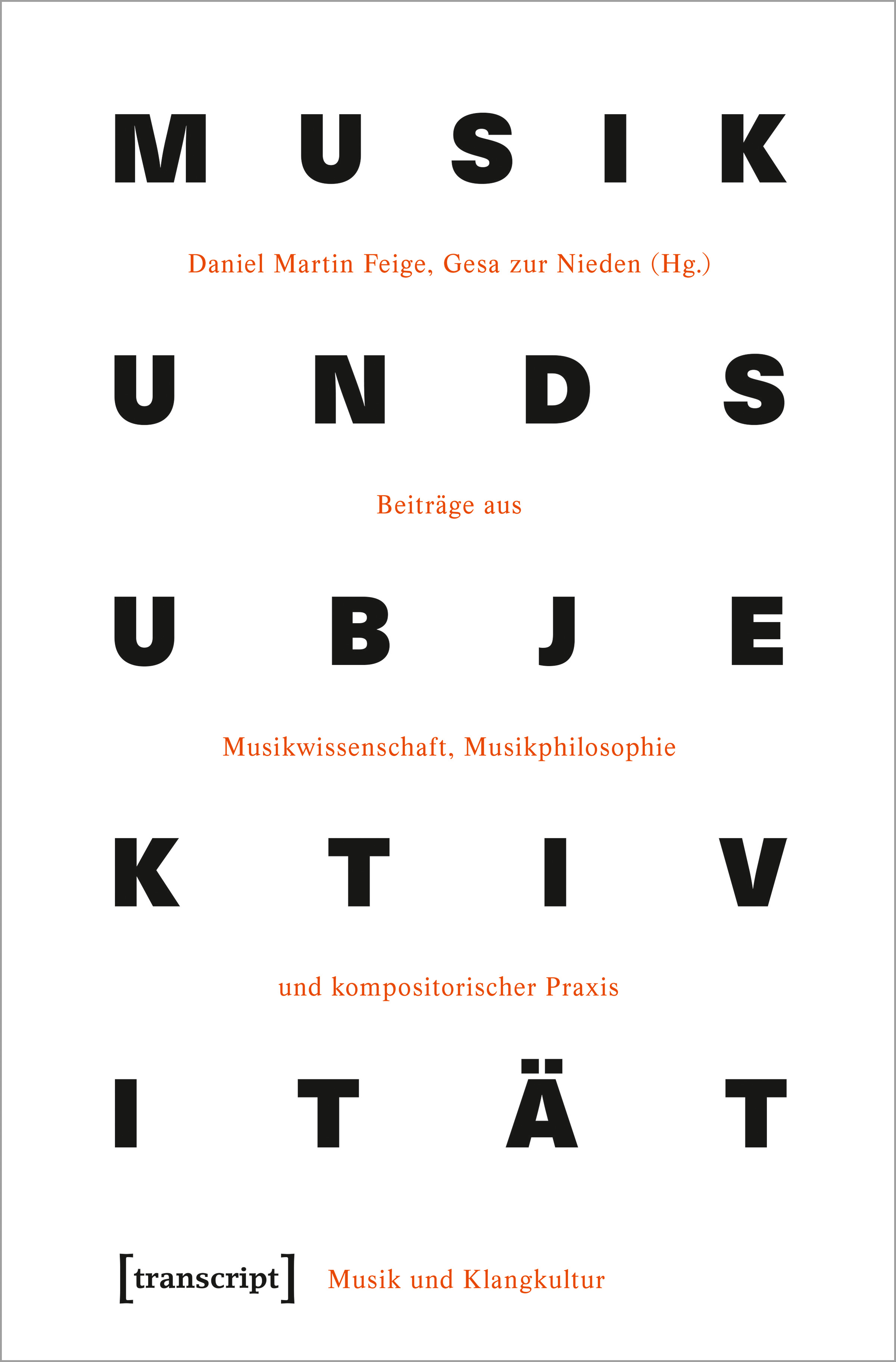 Musik als Musik Hören - oh je, dieses Motto ist ein Ohrwurm, der in der täglichen Jazzhörpraxis auf eine harte Probe gestellt wird.
Musik als Musik Hören - oh je, dieses Motto ist ein Ohrwurm, der in der täglichen Jazzhörpraxis auf eine harte Probe gestellt wird.
Von „musikalischer Seelenentblößung“ lesen wir zum Beispiel dieser Tage über einen bestimmten Trompeter; er sei „auf der Suche nach der nackten Wahrheit“. Oder der Satz eines jüngeren Jazzmusikers (er soll anonym bleiben) aus den liner notes seines neuen Albums, wonach seine Musik „viele Schichten von Gedanken und Gefühlen enthält“, die er in den Vormonaten nicht habe freilassen können.
Der allgegenwärtigen Gefühlsduselei in der Jazzkommunikation lässt sich schön der Vogel zeigen:
„(…)würden wir Musik allein aufgrund ihrer psychischen Effekte schätzen, dann würde sich diese Art der Wertschätzung nicht von jener unterscheiden, die wir jedem beliebigen Werkzeug entgegenbringen, das die gleichen Effekte (…) herbeizuführen vermag“.
Also, „Musik als Musik“ hören - zugegeben: ein Ideal, das sich nur unter Mühen erreichen lässt; Vogel ist nicht der erste, der es postuliert.
Dazu muss man Musik verstehen.
Und hier - Achtung - baut Matthias Vogel nicht, wie befürchtet, Hürden auf. Sein Zauberwort lautet: „nachvollziehendes Verstehen“ von Musik. Und das verlangt keineswegs den Experten, sondern ist eigentlich etwas sehr Einfaches und Naheliegendes:
„Es heißt nicht, den Zusammenhang von Klangereignissen zu erklären, sondern zu erfahren“.
Wer also nicht so gut über sein Musikerleben reden kann, der - oder die - gibt damit nicht zu erkennen, dass er eine Musik nicht verstanden hat. Und die häufigste Aktivität des Nachvollziehens von Musik - auch sie ist so naheliegend, dass man sie gar nicht recht bemerkt - besteht laut Matthias Vogel in „körperliche(n) Bewegungen, darunter Tanz und Gesten“.
Formen des Musikverstehens beschäftigen Vogel spätestens seit dem von ihm co-edierten Band „Musikalischer Sinn“ (2007). Man findet dazu gut nachvollziehbare Essays später auch in - wie erwähnt - „Pop Weiter Denken“, hier bei Feige/zu Nieden, aber auch im Parallelband von Mahnkopf/Fuhrmann.
Wie gesagt, sie handeln von Musik allgemein, damit auch von Jazz. Der Markierstift ist bei der Lektüre ähnlich in Bewegung wie unsereins beim Musikhören, er kennzeichnet damit viele Injektionen gegen die allgegenwärtigen Zumutung der Jazz-Ideologie.
Also, das Bewegungsangebot, das Musik bietet, wird real oder in der Fantasie vollzogen. Es kann auch unterbleiben - wenn uns eine Musik nicht anspricht.
In diesem sehr persönlichen Erfahrungsraum aber sind wir frei.
„Man kann somit sagen, dass Musik qua der von ihr angebotenen Nachvollzüge ein Medium der Selbstbegegnung ist. Sie ein Medium der Selbstreflexion zu nennen, scheint mir hingegen tatsächlich nicht gerechtfertigt zu sein“.
Adorno sagt „Guten Tag“
„Musik als Musik“ hören, das ist ein Ideal, das sich im Alltag nur schwer behaupten kann - zu sehr werden wir mit Zusatz-„Informa-
tionen“ etwa zum Jazz überschwemmt. Zum Beispiel von dem Evergreen einer gesellschaftskritischen Funktion des Jazz.
Davon ist auch der Beitrag des Soziologen Martin Niederauer aus Wien geprägt.
Dabei klingt der Titel ganz erwartungsfroh: „Über die Chancen einer gelungenen Jazzimprovisation“.
Wollten wir das nicht schon immer wissen?
Leider interessiert sich Niederauer nicht für die Musik, sondern trägt weiträumig Bedingungen zusammen, unter denen Jazz eine Form von Gesellschaftskritik gelingen könne.
Dafür sieht er beim Jazz zunächst einmal ganz schlechte Karten. Er sei „kein Gegenstück zur Kulturindustrie, sondern deren fester Bestandteil und (trage) auf seine Weise zur Durchsetzung und Verhärtung kapitalistischer Herrschaft auf einer kulturellen Ebene bei“.
Wohlgemerkt, wir zitieren nicht aus einer Flugschrift der Jahre 1968 fff, sondern aus dem Jahre 2022.
Egal, unter diesen denkbar schlechten Voraussetzungen könne dem Jazz gleichwohl „auf einer ästhetischen Ebene eine Form der Gesellschaftskritik“ gelingen. Und zwar so, dass „die Reproduktion herrschaftlicher Kategorien sowie die Reduktion von Individuen auf Merksmalsträger kurzzeitig unterlaufen werden können“.
Das ist nichts weiter als die auf Bühnen und in Studios vielfach vollzogene Praxis von JazzmusikerInnen. In der Sprache der Deutschen Jazz Union:
„Zur freien Entfaltung und Förderung aller vorhandenen Potenziale gehört eine von Anerkennung und Wertschätzung getragene Jazzkultur, in der die individuelle Identität und Diversität aller Beteiligten respektiert wird.“
Niederauer schwebt Ähnliches vor, er formuliert es nur anders: „InteraktionsteilnehmerInnen (sollten) sich nicht auf Träger sozialer Eigenschaften reduzieren“ (unter uns: dazu haben sie in einem uptempo swing gar keine Zeit) und von „Zuschreibungen und Reduktionen“ auf Kategorien wie „Ethnizität, ´race´, Geschlecht, Sexualität usw“ absehen.
Niederauer nennt diese Begriffe - recht überraschend - „herrschaftliche Kategorien“.
Das ist sein Trick. Ohne die Bedeutungsverschiebung, z.B. „Geschlecht“ als „herrschaftliche Kategorie“ auszugeben, bliebe sein Fazit in der Luft hängen:
„Mit diesen Charakteristika und Potenzialen lässt sich eine gelungene Jazzimprovisation als eine ästhetische, punktuell gelebte Kritik gesellschaftlicher Herrschaft interpretieren“.
Wow, das sitzt.
Aber im Ernst, ist das eine Erkenntnis? Wer würde sich trauen, einen solchen Gedanken - an der Bar, nach dem Konzert - seinen Freunden zuzumuten?
Das ist ein Gedanken-Soufflé, das hoch aufschäumt und mit der letzten Zeile zusammensackt:
„Letztendlich ist es nur Musik - nicht mehr, aber definitiv auch nicht weniger“.
Ach ja, im Satz davor lässt Niederauer noch mal kurz Adorno Guten Tag sagen, indem er jenem (selbstverständlich viel komplizierter) eine Variante dessen zu sprechen gibt, was er vorher selbst geäußert hat.
Sitzt Keith Jarrett in- oder außerhalb der Zelle?
Segelt Martin Niederauer so hoch über der Musik, dass sie keine Konturen mehr zeigt, begibt sich Sebastian Sternal mitten hinein; der Jazzpianist aus Köln und Jazzprofessor an der Universität Mainz beschäftigt sich mit einem zentralen Thema der Jazz-Ästhetik:
„Do I have a voice? Die Suche nach der eigenen Stimmme: Personalstile im Jazz“.
Er bietet Beispiele dessen, was man in Wissenschaftskreisen „anekdotische Evidenz“ nennt, in diesem Falle sind das durchweg ansprechende Zitate von Pianisten wie Hal Galper, Keith Jarrett, Brad Mehldau.
Galper z.B. meint, den Personalstil von John Coltrane in sehr kleinen Einheiten gefunden zu haben: in 7 Gruppen von 4 Tönen, wie er sie in „Giant Steps“ herausgehört habe.
Die Zitate klingen gut, aber sie erschließen nicht das ganze Feld. Es fehlt ein systematischer, übergreifender Gedanke. Wie die Weimar Jazz Database - empirisch! - zeigt, ist das Feld erheblich komplexer.
Sternal nimmt die Zitate für bare Münze. Im Falle von Keith Jarrett (wie auch dieser selbst) unterliegt er einer Kategorienverwechslung.
Jarretts Ausgangspunkt ist „a cell“ („eine Zelle“); offenkundig versteht er darunter eine musikalische Figur (vielleicht, siehe Coltrane, eine Figur von 4 Tönen).
„And that cell is your voice“.
Ok, vorausgesetzt diese Figur wird auch wirklich von allen erkannt (ein Problem, auf das Sternal nicht eingeht), dann könnte man diese Aussage im Sinne von Hal Galper so stehenlassen. Für den Moment.
Aber dann verliert sich Jarrett in einem Gedankensalat, wie man ihn sich pianistisch nur als völlig verstimmt vorstellen kann:
„And then you want that cell to replicate in whatever direction it wants per microsecond. And that´s when you expand it, and it becomes not a personality anymore, it becomes a biofeedback mechanism. Otherwise, what feedback to you get from playing what you like?“ (aus guten Gründen bleibt diese Passage unübersetzt).
Der Denkfehler von Keith Jarrett: er verwechselt einen biologischen mit einem ästhetischen, also von Menschen gemachten Prozess.
Sternal übernimmt Jarretts Bild und hält es für „hilfreich“:
„Auch deswegen, weil es an einen natürlichen, gleichsam biologischen, selbständig ablaufenden Vorgang denken lässt, auf den der Improvisierende nur begrenzt Einfluß hat (oder sogar: haben sollte, um die ´Natürlichkeit´ nicht zu gefährden?)“.
Und wenig später: „Diese Vorgänge finden natürlich zu einem großen Teil unbewusst statt“ - eben nicht. Es handelt sich um das unterbewußte Vollziehen von eingeübten Mustern, die alltagssprachlich im „Muskelgedächtnis“ geparkt sind (ohne jetzt die komplizierte Senso-Motorik dahinter ausbreiten zu wollen).
Brad Mehldau hingegen argumentiert ästhetisch - und durchaus widersprüchlich.
Einerseits macht er sich lustig über Monk-Interpretationen von Kollegen, die gar nicht bemerkten, welche Anforderung an den Solisten allein schon die Monk-Themen stellen. Andererseits relativiert er:
„Für mich hängt der Erfolg einer Improvisation nicht davon ab, wie gut sie in den gegebenen Kontext der Komposition passt - schließlich wollen wir nicht unbedingt hören, wie jemand versucht, Monk zu imitieren, wenn er ein Monk-Stück spielt. Der Erfolg hängt vielmehr davon ab, inwieweit das Solo den Kontext des Stücks transzendiert, so dass wir die Frage des Kontexts überhaupt nicht mehr stellen“.
Man muss Sternal zugute halten, dass er das Dilemma durchaus erkennt. Ohne seine Eingangsfrage erschöpfend zu beantworten, rettet er sich in ein Paradoxon, das zumindest sprachlich eine vorläufige Lösung bietet:
„Viele Jazzmusiker*innen beschreiben, dass sie ihre eigene Stimme in dem Moment gefunden haben, als sie nicht mehr danach gesucht haben, nicht mehr versuchten, sie zu besitzen. Um mit Erich Fromm zu sprechen: Sie ist ´Sein´, nicht ´Haben´“.
PS: diese Rezension beschränkt sich auf die Kapitel im Buch, die Berührungspunkte zum Jazz haben.
erstellt: 03.03.22
©Michael Rüsenberg, 2022. Alle Rechte vorbehalten
